
Mit den Zeitsplittern feiern wir die Zeit. Melden Sie sich jetzt für unseren Newslettter an und erhalten Sie Inspiration zu den Facetten der Zeit - immer zum Beginn der Jahreszeiten.
#22 GREGORS AUSSETZER
DREI REGELN ZUR EWIGKEIT
Uhrmacher forschen seit Jahrhunderten an mechanischen Lösungen, um die Anzeige des Datums auf ewig mit dem Kalender zu synchronisieren. Neben den unterschiedlichen Monatslängen berücksichtigen sie dabei auch die Schaltjahre des gregorianischen Kalenders: ihre vierjährige Wiederkehr, ihr Aussetzen alle 100 und das Aussetzen des Aussetzens alle 400 Jahre. Alles, um ein hehres Ziel zu erreichen: die auf Ewigkeit angelegte genaue Verortung des Tages im Monat, des Monats im Jahr und die richtige Korrelation zum Wochentag. Sie verwirklichen dies meist mit einem sogenannten Programmierrad: einer sich langsam drehenden Scheibe, auf der durch Vertiefungen die Schaltjahre eingeschrieben sind.
Und so zeigt sich: Selbst die Ewigkeit ist nur ein kreisendes Auf und Ab.
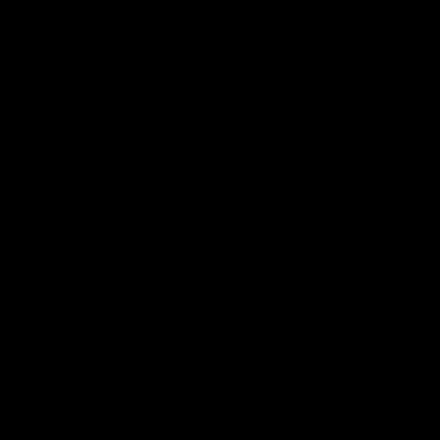
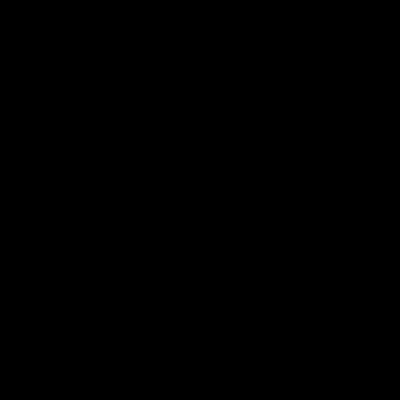
#21 TEATIME, KAFFEEKLATSCH, APÉRO
IST AUCH DIE ZEIT MAL UNPÜNKTLICH?
Eine Sprache ohne Zeit existiert nicht – denn Zeit ist ein grundlegendes Element des Zusammenlebens. Die Beschreibung von Zeitlichkeit ist eine zentrale Eigenart der kommunikativen Kultur, daher können Menschen überall die Aspekte Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ausdrücken. Aber der korrekte Zeitpunkt wird in allen Sprachen unterschiedlich markiert, denn Sprachen differenzieren sich stark in den grammatikalischen Konstruktionen der Zeit: In den indoeuropäischen Sprachen wird sie z. B. primär durch die Zeitform des Verbs definiert, im Chinesischen hingegen hauptsächlich durch zeitbestimmende Adverbien.
Für Pünktlichkeit ist nicht allein die Präzision der normierten Uhrzeit entscheidend – wichtig ist vor allem, dass wir die sprachlichen Konventionen für den richtigen Zeitpunkt kennen.
#20 ZEIT-ZEICHEN
WIDER DER VERENGUNG DES RAUMS ZUM PUNKT
Seit Erfindung der Sonnenuhr drehen sich Uhr-Zeiger im Kreis und versinnbildlichen die Unendlichkeit des Zeitflusses. Sie stellen eine Raum-Zeit-Korrelation her: Beim Vergehen der Zeit wandern sie durch einen realen Raum. Ohne Rechnen erkennen wir auf den ersten Blick, wie lang etwas davor oder dahinter liegt. Aber viele Kinder können die Zeiger nicht mehr deuten, denn die numerische Anzeige beherrscht immer mehr die Darstellung der Zeit. Sie versteckt die Unschärfe des Zeit-Raums und trennt das Vorher vom Nachher. Ihr rein Zeit-Punkt-zentriertes Konzept verspricht uns Pünktlichkeit, Berechenbarkeit, Wirtschaftlichkeit.
Macht sie uns so zu Getriebenen?
Oder müssen wir der Zeit einfach wieder Raum geben?
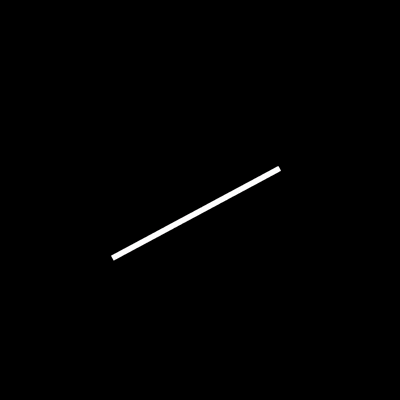
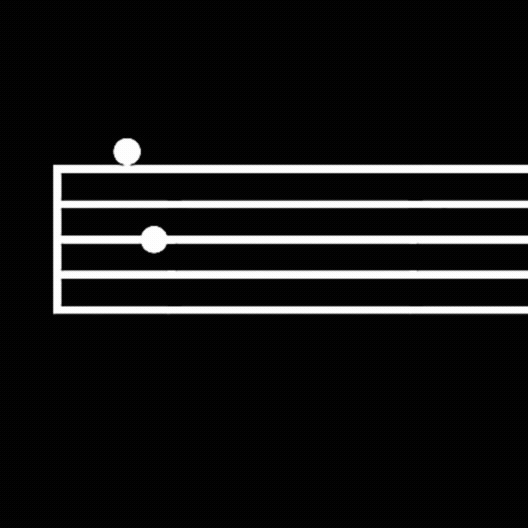
#19 ZEIT IN KLANG GEGOSSEN
DIE ÜBERWINDUNG DES MOMENTS
Zeit macht die Musik. Zeit organisiert Klänge und Geräusche zu Melodie und Rhythmus, zu Klangfarben und Harmonien. Erst durch die zeitliche Anordnung entsteht der Klangfluss, dem wir uns nicht widersetzen können. Musik aktiviert beim Hören umgehend die Gehirnregionen für Emotionen, Bewegung, Kreativität und wird direkt ins Gedächtnis geschrieben. Sie eröffnet uns beim erneuten Hören Regionen der Erinnerung, die sonst selten zugänglich sind. So kann sie uns in die Vergangenheit transportieren, ein Gefühl für Gegenwart erzeugen oder eine emotionale Brücke in die Zukunft aufschimmern lassen.
Musik ist ohne Zeit nicht möglich, aber Musik ermöglicht uns, aus dem Moment zu treten: Musik ist Zeit, in der die Zeit stillsteht.
#18 GRAUE MÄNNER IN BUNTEN ANZÜGEN
ZEITVERPRASSEN
Die Agenten der Zeitsparkasse sind unter uns. Social Media, Shopping, Binge-Watching - die Möglichkeiten zum Zeitvertreiben sind vielfarbig. Wir verschenken unsere Zeit an kommerzielle Anbieter, davon leben diese wie Vampire. Unsere Zeit ist ihr Geld. Gleichzeitig hoffen wir, durch Sparen der restlichen Zeit belohnt zu werden. Wir tarieren unsere Work-Life-Balance. Wir wollen mehr Zeitwohlstand erreichen, indem wir materiellen Wohlstand aufgeben. Aber es bleibt doch beim Vertreiben, mit seinen Synonymen: verscheuchen und verkaufen.
Vielleicht müssen wir anfangen, die Zeit nicht zu vertreiben, sondern zu verprassen; die Zeit bewusst mit vollen Händen ausgeben und zu wissen, dass sie endlos ist. Denn auch wenn wir glauben, wir leben nur einmal, so ist es doch anders: Wir sterben nur einmal – aber leben jeden Tag


#17 DIE ZEIT MACHT DEN UNTERSCHIED
VOM WERT DES AN UND AUS
Kurz an, Kurz aus, Lang an: Diese drei Zeitspannen reichen aus, um eine Nachricht in die Welt zu schicken.
Vor fast 200 Jahren stellte Samuel Morse die ersten Vorläufer des späteren Morsecodes vor und veränderte damit die globale Kommunikation. Sein System zur Datencodierung war revolutionär, da es rein den zeitlichen Verlauf des Signals zur Informationsübertragung nutzt.
Mit Kurz an, Kurz aus, Lang an können Buchstaben, Ziffern oder weitere Zeichen flexibel und unabhängig vom Medium übertragen werden – durch Ton, Licht, Vibrationen. Seitdem verbreiten sich Nachrichten rasant um die ganze Welt.
So ist Morses Code das beste Symbol dafür, dass Nachrichten eben Zeit benötigen – Zeit, um bei uns im doppelten Sinne anzukommen.
#16 SCHAUE NACH RECHTS UND LINKS
ZEITPERSPEKTIVEN
Der Fluss der Zeit ist unerbittlich, durch die Gegenwart entsteht aus Zukunft ständig Vergangenheit. Viele Menschen entwickeln im Laufe des Lebens einen individuellen Blick auf diesen Fluss – die persönliche Zeitperspektive. Ist sie auf die Vergangenheit gerichtet, deute ich vieles nur aufgrund des Erlebten; fokussiere ich auf die Zukunft, lotsen mich vor allem meinen Erwartungen; ist die Gegenwart mein Mittelpunkt, lasse ich mich vom Moment leiten. Wenn diese Zeitperspektive zu starr ist, betrachten wir das Leben nur aus ihrem Blickwinkel und errichten uns so Gedankenbarrieren. Aber dank der Flexibilität des Atlasgelenkes können wir unsere Perspektive verändern – wir müssen nur mit dem Kopf auch unsere Gedanken bewegen.


#15 ZÄHLE BIS DREI, NICHT BIS VIER UND NICHT BIS ZWEI
DREI SEKUNDEN EWIGKEIT
Von der Vergangenheit zur Zukunft gleitet die Gegenwart durch den Zeitpfeil. Diese Richtung ist unumkehrbar, denn Leben findet nicht rückwärts statt. Unsere subjektive Gegenwart hat dabei eine Ausdehnung von etwa drei Sekunden. Nur innerhalb dieser Spanne kann unser Gehirn Informationen zusammenfassen und somit Ereignisse als gleichzeitig begreifen.
Diese drei Sekunden sind der Übergang von der bewegten Vergangenheit hin zur dynamischen Zukunft. Jedoch vergehen diese Sekunden nicht, sie fliessen stets mit und existieren für immer – so findet sich Ewigkeit in der Gegenwart.
#14 SCHATTENVERSTECKE
ZWEI UNGLEICHE GESCHWISTER
Mittag. Die Sonne steht an ihrem höchsten Punkt und der helle Tag erreicht sein Maximum. Gleichzeitig, Mitternacht. Auf der anderen Seite. Die Sonne steht an ihrem tiefsten Punkt und die Dunkelheit der Nacht umhüllt das Leben. Mittag und Mitternacht sind wie zwei Geschwister, die sich nie treffen, die aber nicht ohne den anderen existieren. Der Mittag überstrahlt mit der Sonne die Dunkelheit, selbst die Schatten verkriechen sich, überall ist Licht. Er ist der Höhepunkt. Die Mitternacht aber ist der Übergang. In ihrer Dunkelheit bewahrt sie die Helligkeit. Erst durch sie wird Licht sichtbar, selbst das kleinste Schimmern leuchtet. Geisterstunde. Die Schatten kriechen wieder hervor und das Ende des alten Tages wird zum Beginn des neuen Sonnenaufgangs.
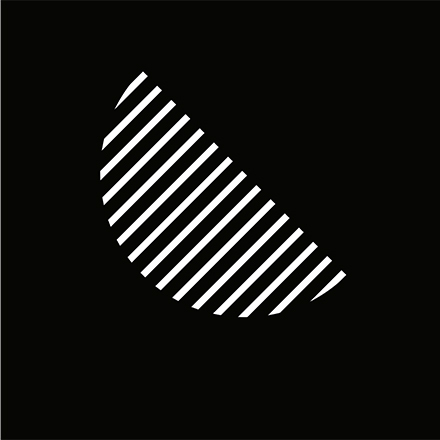
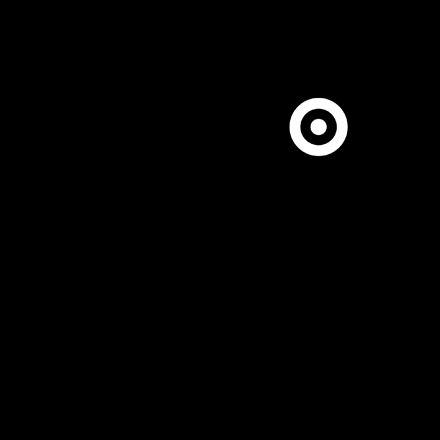
#13: DUNKELZEIT
UNENDLICHE WEITEN
Es ist ein stetiger Wechsel: Die Nacht kommt, der Tag geht, das Licht kommt, das Licht geht. Der Tag ist die Zeit der gesellschaftlichen Kooperation, der Absprachen, des Bewahrens. Die Nacht hingegen ist die Zeit der Erneuerung, die Zeit der Veränderung, sie bedeutet Freiheit und Konzentration auf das Wesentliche. In der Dunkelzeit kehrt Ruhe ein, das Schlafen der Anderen befreit von Erwartungen, die Ablenkungen versiegen, sie macht kreativ. Die Mitternacht ist der dunkelste Moment. Tiefe Schwärze umgibt uns, aber das Leuchten des kleinsten Schimmers fokussiert die Gedanken und das Funkeln der Sterne öffnet den Horizont.
#12: MONDBREMSE
DIE ENTSCHLEUNIGUNG DER ERDE
Für uns definiert die Sonne das Jahr und den Tag; jene Zeiträume, nach denen sie jeweils wieder am gleichen Punkt am Himmel steht. Aber dieser Takt ist nicht unveränderlich - vor 400 Millionen Jahren war ein Tag rund zwei Stunden kürzer und ein Jahr zählte ca. 35 Tage mehr. Der Mond verlängert die Dauer eines Sonnentages. Mit seiner Gravitationskraft erzeugt er Wellenberge, die ihm als Gezeiten über unseren Planeten nachfolgen und so die Form der Erde kontinuierlich verändern. Durch den Pirouetteneffekt verringern die Wassermassen dabei die Geschwindigkeit der Erdrotation. Und so bremst der Mond die Erde um jährlich ungefähr 23 Millionstel-Sekunden.
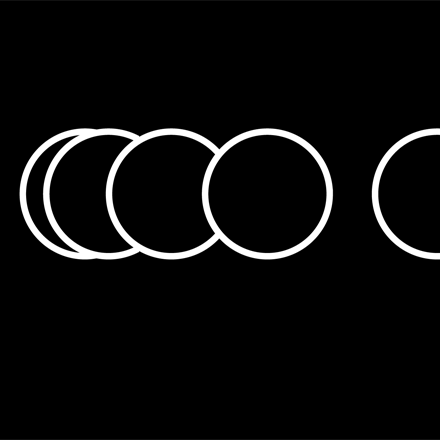
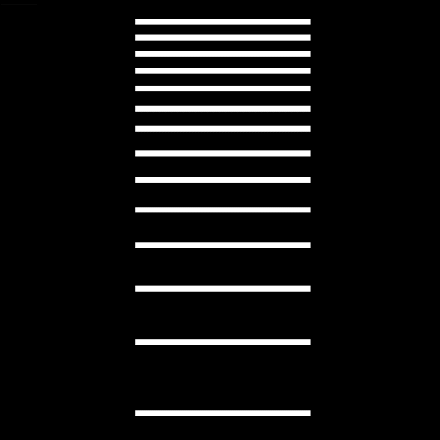
#11: LEBENSRHYTHMEN
GEZEITEN
Der Rhythmus unserer Gesellschaft wird definiert durch den Sonnentag. Jenen 24 Stunden, nach denen die Sonne durch die Erdrotation wieder im Zenit steht und die unser soziales Leben strukturieren. Aber für Bewohner der Küsten ist das sich wiederholende Kommen und Gehen des Wassers ebenso bedeutsam. Landzugänge werden überflutet, Schifffahrt ermöglicht, alles Leben pulsiert zwischen Ebbe und Flut. Allerdings verändert sich die Küstenlinie asynchron zur genormten Uhrzeit, der Takt der Gezeiten ist länger. Denn er wird durch die Gravitation des Mondes bestimmt und dieser hat erst nach 24 h und 50 min die Erde einmal scheinbar umrundet. Zur Rotation der Erde addiert sich der Weg des Mondes auf seiner Umlaufbahn um die Erde. So sendet der Mond uns allen eine Botschaft: halte deine Gewohnheiten flexibel und achte auf deine Umgebung.
#10: EINE LEERE VOLLER ZWISCHEN
«MA» EIN KONZEPT VON RAUM UND ZEIT
Mit MA beschreiben Japaner die beabsichtigte Distanz, die durch eine kurze Pause zwischen Handlungen oder durch den leeren Zwischenraum von Objekten entsteht. Eine Distanz, die jedoch nicht Trennung, sondern eine besondere Verbindung darstellt. MA kann die Stille zwischen Noten sein, die die Musik erst entstehen lässt, das kurze Verharren, das eine Handlung betont oder das Volumen, für das eine Schale geschaffen wurde. Es ist ein raumzeitliches Konzept, das sich von der westlichen, auf scheinbare Effizienz getrimmten Sicht auf Leere fundamental unterscheidet: MA ist das Dazwischen, welches Bedeutung verleiht und voll von Möglichkeiten ist.
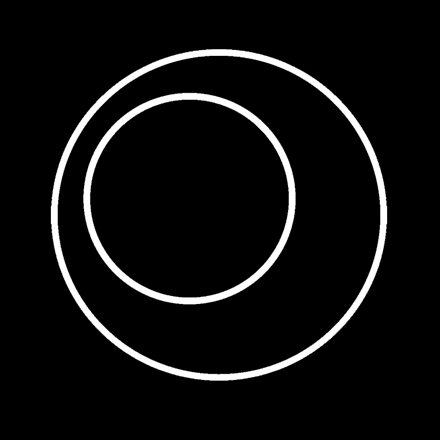
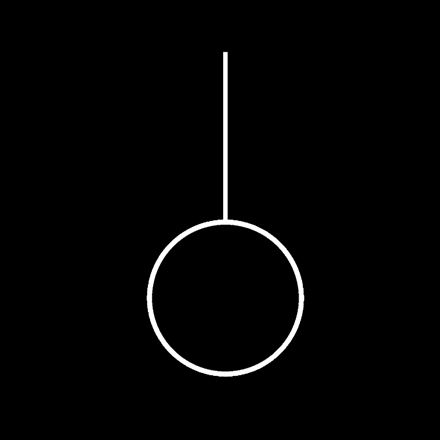
#9: STILLSTAND
DIE DEHNBARKEIT DER ZEIT
Für viele Menschen ist es eine der erdrückendsten Zeitempfindungen: das Warten. Es passiert nichts, die gesamte Wahrnehmung ist auf das Erreichen des ersehnten Ziels fokussiert, alle anderen Eindrücke sind wie ausgeblendet. Sekunden werden zu Minuten, Minuten zu Stunden, Stunden zu Tagen. Die Uhr tickt kontinuierlich, der Mensch hingegen misst die Zeit in der Anzahl neuer Eindrücke: Erleben wir wenig Unbekanntes, schleicht die Zeit – aber sie rast, wenn wir viel erleben.
Der industrialisierte Umgang mit der Zeit ist geprägt von der Gleichförmigkeit der Zeigerdrehung. Aber zeigt diese den wirklichen Verlauf der Zeit an?
#8: TEMPUS FUGIT? OSCILLAT!
HARMONISCHE UNRUH(E)
Der Name für das Herz der mechanischen Uhr ist in den meisten
Sprachen mit dem Begriff „Balance“ verbunden. Nur im Deutschen heisst es
Unruh und wird damit weniger nach dem technischen Prinzip, sondern nach
seinem Wesen benannt: Ihr ewiges Hin und Her hemmt das kontinuierliche
Abwickeln der aufgezogenen Feder und gibt dem Werk so den Takt vor.
Durch ihr ausbalanciertes, harmonisches Schwingen entstehen immer gleich
lange Zeitabschnitte. Mit Hilfe der Zahnräder werden diese aufsummiert
und der Lauf der Zeit durch die Zeiger in den uns vertrauten Einheiten
dargestellt.
Das typische Ticken einer mechanischen Uhren bekundet es: hier vergeht die Zeit nicht, sie schwingt.
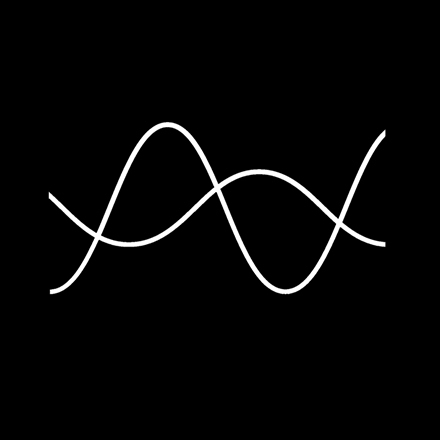
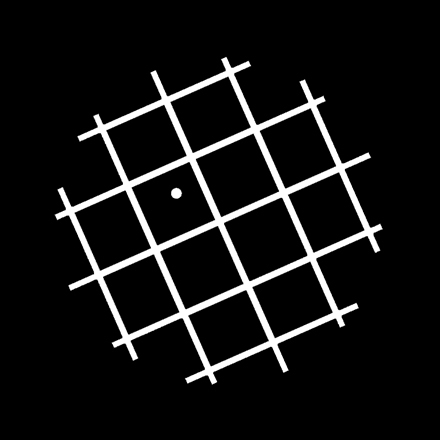
#7: 60 - SIE TEILT ZEIT UND WINKEL
47° 33‘ 29“ N
07° 35‘ 16“ O
Die Bewohner Mesopotamiens entwickelten vor tausenden Jahren die Berechnung des Kalenders und die Geometrie. Sie rechneten dabei im 60er-System - so konnten sie mit dem Daumen über die Einzelglieder der anderen Finger bis 12 zählen und dies mit den fünf Fingern der zweiten Hand bis zur 60 multiplizieren. Dieses System passt perfekt zu den 24 Stunden des Tages und den 360 Grad des Kreises. Die 60er–Brüche benannten die Römer dann pars minuta und pars minuta secunda.
So trotzt die 60 dem metrischen System und vereint uns mit dem Entdeckergeist vergangener Epochen.
#6: ZEITWEISER
STERNSTUNDEN AM FIRMAMENT
Durch die Eigendrehung der Erde scheinen sich die Sterne am Himmel zu bewegen. Sie umkreisen den Himmelsnordpol einmal pro Tag und so kann man sie nachts als Zeitmesser nutzen. Die gedachte Linie zwischen Polarstern und Großem Wagen weist die Zeit: sobald sie sich um 15° weitergedreht hat, ist eine [Stern]Stunde vergangen.
Die meisten Menschen assoziieren mit Sternstunden einen einmaligen Moment oder eine positive Entwicklung. Ist es nicht traumhaft, dass sich dies Nacht für Nacht wiederholt?
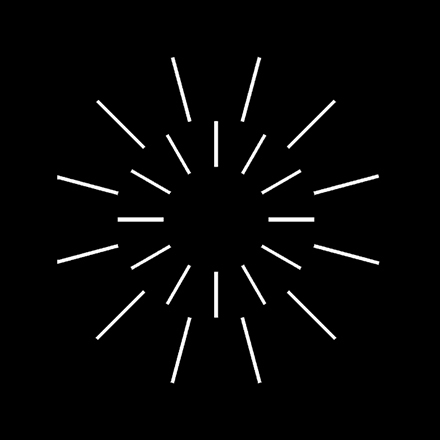
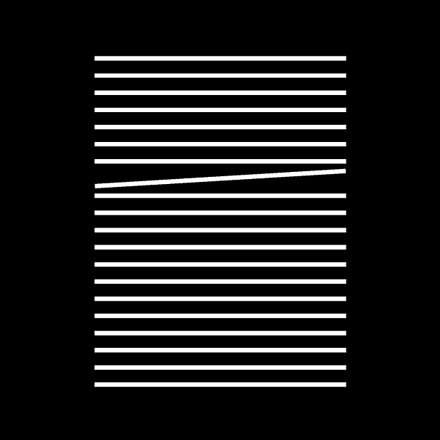
#5: MORGENGRAUEN
ALLER TAGE ANFANG
Schichtarbeiter und Langschläfer kennen dieses Grauen: morgens, wenn der Körper nach Schlaf ruft und alle Fasern sich gegen das Wachsein sträuben. Sie verfluchen diese Zeit der Morgendämmerung, in der der Himmel blau, rot oder golden leuchtet. Doch der Begriff ist nicht vom mittelhochdeutschen «grûwen» (Entsetzen erleben) abgeleitet, sondern von «grāwen» (grau werden). Denn den wahren Anbeginn des Tages markiert ein scheues Grau, nur sichtbar bei unbedecktem Himmel – für Frühaufsteher die schönste Stimmung des Tages.
#4: CECI N’EST PAS UNE HEURE
ZUR BLAUEN STUNDE
Die blaue Stunde taucht alles in ein ganz besonderes Licht – nicht nur zur Inspiration von Fotografen, Künstlern und Literaten. Ihren Namen verdankt sie der intensiven Himmelsfärbung: Das blaue Lichtspektrum dominiert, da das Sonnenlicht schräg in die Ozonschicht einfällt. Die blaue Stunde beginnt mit dem Sonnenuntergang, ihre Länge jedoch hängt ab von Breitengrad und Datum. Zum Sommerbeginn am 21. Juni sind es in Basel 40, in Hamburg 54 Minuten – eine Zeitspanne muss also keine 60 Minuten dauern, damit wir sie Stunde nennen.
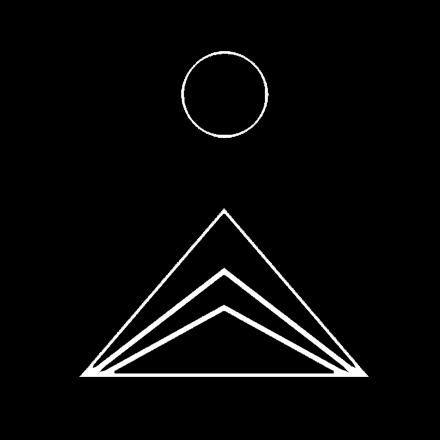
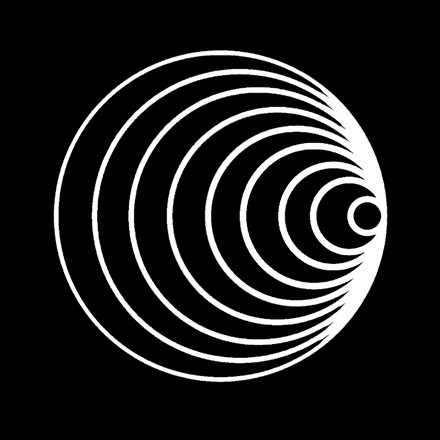
#3: AUCH ZEIT MACHT MAL PAUSE
DIE SCHLEICHENDE SEKUNDE
Dass sich der Sekundenzeiger von mechanischen Uhren fliessend durch die Minuterie bewegt, ist eine Illusion: Bei der «Schleichenden Sekunde» vollführt der Zeiger kaum wahrnehmbare Schritte, definiert durch die Anzahl Halbschwingungen der Gangreglung. Je nach Werk sind es sechs bis zehn Teilschritte – immer mit einer winzigen Pause dazwischen.
#2: NUR EIN AUGENBLICK
EIN AUGE
EIN BLICK
EIN MOMENT
Ist ein Augenblick die Zeit zwischen zwei Lidschlägen – vier, fünf,
sechs Sekunden? Oder ist er die Zeit, die der Lichtstrahl braucht, um
auf unserer Netzhaut das Sehen auszulösen – Bruchteile einer Sekunde?
Oder ist es die Zeit, bis wir unseren Blick abwenden?
In einem
Augenblick können wir uns verlieren, uns verlieben oder verweilen.
Augenblicke sind kein Mass für die Zeit, sondern eine Einheit voller
persönlicher Bedeutung.
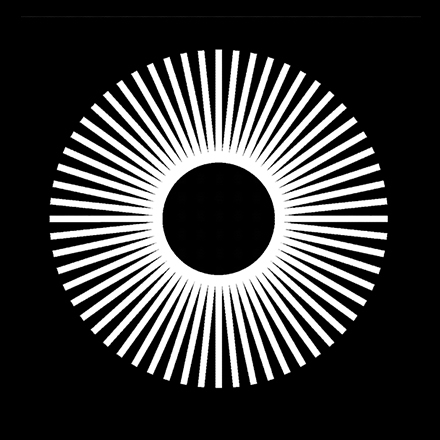
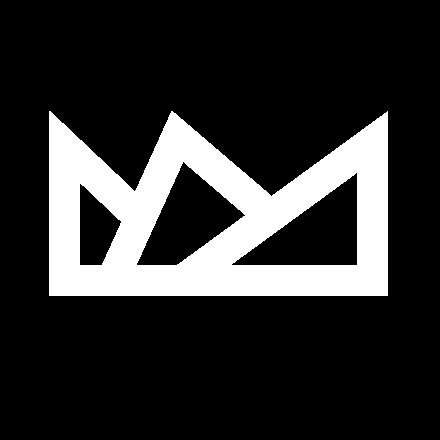
#1: KALENDERSYSTEME
Seit Jahrtausenden versuchen die Menschen, Tageslänge, Mondumlauf und Sonnenjahr in Einklang zu bringen und so den Jahreslauf für Landwirtschaft, Wanderbewegungen oder religiöse Rituale zu strukturieren.
Der Gregorianische Kalender bildet das Sonnenjahr ab, berücksichtigt aber z. B. das mondabhängige Datum des Osterfestes. Er wird als Referenz weltweit genutzt, wohl auch da er erst in über 3000 Jahren um einen Tag abweichen wird. Der Kalender der muslimischen Welt hingegen orientiert sich konsequent am Mond, daher wandert der Anfang des Monats Ramadan in etwa 33 Jahren einmal durch das Sonnenjahr. Andere Kulturen kennen zusätzliche Rhythmen; so nutzten die Maya eine 52jährige Zählung für ihre Geschichtsaufzeichnung und der chinesische Kalender verdeutlicht mit seinem 60er Zyklus den wiederkehrenden Charakter der Zeit.
So logisch er uns auch erscheint, ein Kalender ist immer auch ein Abbild der Kultur in der er entsteht.